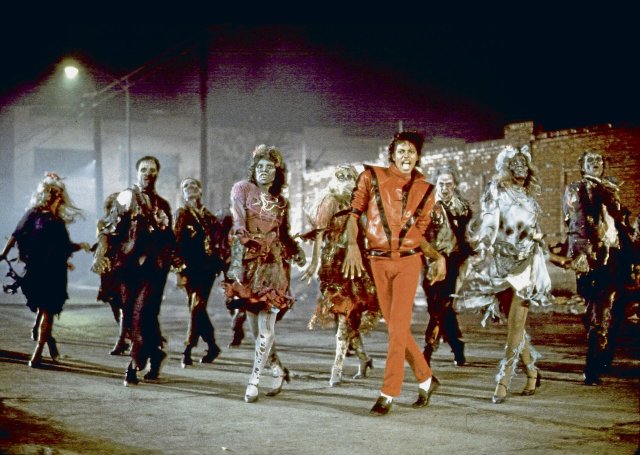- Kultur
- Sexarbeit
40 Jahre Hydra: »Entkriminalisierung wirkt schützend«
Die Beratungsstelle Hydra wird 40. Ein Gespräch mit der Sozialarbeiterin Andrea Stephan über Sparpolitik und die Bedingungen für Sexarbeitende heute

Über den Bereich Sexarbeit kursieren in der Gesellschaft sehr viele Fehlinformationen, und die Lebensrealitäten von Sexarbeitenden sind natürlich sehr vielfältig. Ich würde hier gern ein spezifisches Thema ansprechen, nämlich den Zusammenhang von Sexarbeit und Wohnungslosigkeit.
Ich kann aus der Perspektive von Hydra nur über einen Teil von Sexarbeitenden sprechen, nämlich über diejenigen, die sich mit einem sozialarbeiterischen Hilfebedarf an unsere Beratungsstelle wenden. Bei ihnen stellen wir tatsächlich häufig Überschneidungen der Themen Sexarbeit und Wohnungslosigkeit fest. Wir haben Klientinnen, die auf dem Straßenstrich an der Berliner Kurfürstenstraße arbeiten und zu uns in die Beratungsstelle kommen. Von den Frauen, die hier arbeiten – darunter auch viele Transfrauen – sind viele wohnungslos. Sie alle gehören damit zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Aber das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil unserer Zielgruppe hier bei Hydra. Die meisten unserer Klientinnen arbeiten in Bordellen, in der Escort-Industrie, in Massagestudios oder BDSM-Studios. Aber auch diese Frauen sind oft von prekären Wohnverhältnissen betroffen.
Im Jahr 2017 wurde ja das »Prostituiertenschutzgesetz« (ProstSchG) verabschiedet. Was für Veränderungen haben sich hier für Sexarbeitende ergeben?
Mit dem ProstSchG kam nicht nur die verpflichtende Registrierung aller Sexarbeitenden, sondern auch die Regelung, dass in Prostitutionsstätten nicht mehr gewohnt werden darf. Das ist für viele unserer Klient*innen etwa aus Bulgarien, Rumänien oder Ungarn, die nur für einige Monate zum Arbeiten nach Deutschland kommen, eine große Belastung. Sie dürfen offiziell nicht mehr in den Betrieben wohnen und müssen sich stattdessen für viel Geld irgendwo ein Airbnb oder eine andere Unterkunft mieten – was für viele einfach nicht bezahlbar ist. Aber auch für deutsche Sexarbeiter*innen oder jene mit Wohnsitz in Deutschland stellt das ein Problem dar. Manche arbeiten zwar von zu Hause oder machen Haus- beziehungsweise Hotelbesuche, doch es ist eben nicht für alle möglich, Berufliches und Privates strikt zu trennen – auch wenn das aus Gründen der Psychohygiene vielleicht wünschenswert wäre. Ein weiteres Phänomen, das uns immer häufiger begegnet, ist, dass Personen ihr Einkommen aus Sexarbeit durch Bürgergeld aufstocken müssen, obwohl sie eigentlich ok verdienen. Aber die Mieten sind teils so hoch, dass es zum Leben schlicht nicht reicht – zum Beispiel 1500 Euro für ein Einzimmerapartment.
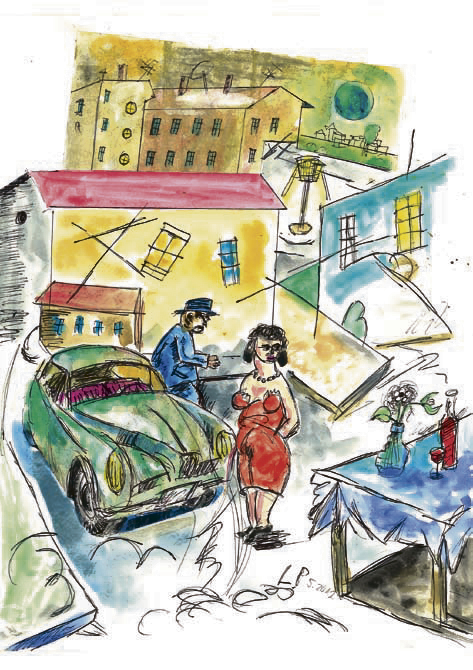
Womit hat die Bundesregierung die Einführung dieses Gesetzes überhaupt begründet?
Die Begründung für das Gesetz war vermutlich der »Schutz« der Sexarbeitenden – so sagt es zumindest der Name. Tatsächlich geht es an deren Lebenswirklichkeit oft vorbei, bedeutet also keine Verbesserung, sondern errichtet zusätzliche Hürden bei der Ausübung der Arbeit – zumal in einer Stadt wie Berlin, in der es kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt. Viele dieser Frauen leben deshalb bei Kunden, in überteuerten Zimmern oder in Abhängigkeitsverhältnissen zu sogenannten Sugar Daddies oder Zuhältern, die ihre Schutzlosigkeit ausnutzen.
Wenn es zu einer staatlichen Kontrolle der Einhaltung des ProstSchG kommt, kann das gravierende Folgen haben. Besonders betroffen sind hiervon oft nicht-weiße Personen oder Menschen ohne deutschen Pass. Viele haben keinen gültigen Aufenthaltstitel und damit noch weniger Zugang zu regulärem Wohnraum oder Unterstützungssystemen. Auch die wenigen Hilfsangebote sind für sie oft unerreichbar, da sie an einen legalen Aufenthaltsstatus gekoppelt sind – jemand ohne gültige Papiere kann keine Zuweisung für eine Unterkunft durch die soziale Wohnhilfe erhalten.
Übrigens ist hier noch festzuhalten, dass das ProstSchG es Menschen untersagt, sich ohne entsprechenden Aufenthalt überhaupt als Sexarbeitende zu registrieren. Und wenn das Gesetz Sexarbeitende tatsächlich schützen wollte, würde es beispielsweise die Zugangsbarrieren zur gesetzlichen Krankenversicherung absenken.
Wie sieht denn die Lage in Hinblick auf Notübernachtungsstellen in Berlin derzeit aus?

Was wir in den letzten Jahren beobachten, ist eine deutliche Verschlechterung der Situation für unsere wohnungslosen Klientinnen. Es wird immer schwieriger, für diejenigen, die konkret einen Schlafplatz brauchen, auch tatsächlich einen zu finden. Bei uns in der Beratungsstelle melden sich vor allem Cis- und Transfrauen, und wenn wir dann alle frauenspezifischen Einrichtungen mit Notschlafplätzen abtelefonieren, sind diese so gut wie immer vollständig belegt. Ein freier Platz ist ein absoluter Glücksfall. Auch die anderen offiziellen Stellen zur Schlafplatzvermittlung wie die Soziale Wohnhilfe sind oft schwer zugänglich und bürokratisch.

Dieser Fall aus meinem Arbeitsalltag zeigt exemplarisch, wie schwierig die Lage derzeit ist: Eine Klientin mit eingeschränkten Deutschkenntnissen bekam in der vergangenen Woche eine Unterkunft zugewiesen. Als sie dort ankam, sagte man ihr, sie müsse den Schlüssel woanders abholen, aber auch an dem Ort traf sie niemanden an. Am nächsten Tag versuchte sie es erneut, verpasste aber letztlich den Übergabetermin, weil sie kein Smartphone hat. Heute war sie wieder hier bei Hydra – ihr Schlafplatz ist nun weg. In der Zwischenzeit hat sie draußen geschlafen. Jetzt kann sie in der Notübernachtung »Evas Obdach«, betrieben vom Sozialdienst katholischer Frauen, übernachten. Da kommt sie allerdings nur nachts unter, tagsüber schläft sie in einem Tagestreff mit einem Hinterzimmer, in dem sich erschöpfte Klientinnen inoffiziell hinlegen dürfen. Das ist vielen Menschen sicher gar nicht bewusst: In Berlin gibt es so gut wie keinen Ort, wo wohnungslose Frauen während des Tages schlafen können. Es gibt zwar Tagestreffs für wohnungslose Frauen, wo man sich mal auf ein Sofa legen darf, aber das ist kein offizielles Übernachtungsangebot. Für Menschen mit Krankheit, Trauma oder anderen Belastungen ist das absolut unzureichend.
Das heißt, die Zahl an Schlafplätzen ist schon jetzt viel zu niedrig und die Hürden für die Betroffenen, überhaupt Zugang zu erhalten, eigentlich viel zu hoch?
Ja, alle sozialen Wohnhilfen sind schlicht überlastet. Besonders betroffen sind auch hier wieder Menschen mit Erfahrungen von Mehrfachdiskriminierung, zum Beispiel durch Sprachbarrieren, psychische Belastungen oder fehlende Dokumente, die beispielsweise in der Wohnungslosigkeit verloren gingen und deren Neubeschaffung auch wieder Geld kostet. Viele dieser Frauen erhalten keinen Schlafplatz, selbst wenn sie es schaffen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, was allein unter diesen Umständen schon eine enorme Leistung ist. Die Dunkelziffer jener, die gar keinen Zugang zu Hilfsangeboten haben, ist hoch. Und selbst wenn die betreffende Person alle Voraussetzungen erfüllt – etwa Leistungsbezug beim Jobcenter oder den Besitz gültiger Ausweise – heißt das nicht, dass sie bei diesen Trägern wirklich einen sicheren Schlafplatz erhalten. Viele Unterkünfte bestehen aus Dreibettzimmern mit kaum tragbaren Zuständen: psychisch stark belastete Mitbewohnerinnen, Gewalt, Substanzgebrauch, schlechte Hygiene. Für viele Menschen ist die Übernachtung in einer solchen Situation einfach keine Option.
Ein Projekt, das das Land Berlin zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit finanziert, ist »Housing First«. Haben Sie bei Hydra damit bereits Erfahrungen gesammelt?
Das Konzept Housing First ist uns grundsätzlich bekannt. Wir halten es für gut und wichtig, aber leider kaum umsetzbar. In fast fünf Jahren bei Hydra ist es mir noch nie gelungen, eine Klientin erfolgreich über dieses Modell zu vermitteln. Gerade versuche ich es bei einer trans Klientin über das Projekt Housing First Queer der Schwulenberatung. Vielleicht klappt es dort, aber auch dieses Angebot ist alles andere als niedrigschwellig, und die Zahl der Leute, die über Housing First in Berlin eine Wohnung gefunden haben, ist meines Wissens ingesamt sehr überschaubar.
Ist das Angebot von Hydra eigentlich ein klassisch sozialarbeiterisches?

Die Sozialarbeit spielt bei Hydra definitiv eine zentrale Rolle. Unser Team besteht unter anderem aus fünf Sozialarbeiterinnen. Zumal für migrantische Klientinnen, die einen Großteil unserer Zielgruppe ausmachen, ist die deutsche Bürokratie kaum allein zu bewältigen. Wir helfen bei der Antragstellung, dem Zugang zum Gesundheitssystem, der Wohnungssuche, beruflicher Umorientierung, beraten zum Zeitpunkt der Aufnahme der Sexarbeit und vielem mehr. Ein großes Thema ist außerdem, wie bereits angedeutet, die Krankenversicherung: Für selbstständige Migrant*innen, die schon in ihren Herkunftsstaaten nicht gesetzlich versichert waren, ist der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland oft sehr schwierig.
Neben der klassischen Sozialberatung bieten wir aber auch psychosoziale Unterstützung an – je nach Bedarf. Manche Klientinnen kommen nur ein Mal, um sich zu informieren, andere werden über einen längeren Zeitraum begleitet. Für akute Krisenfälle haben wir das Projekt »Akute Traumahilfe« aufgebaut. Darüber können wir bis zu zehn Therapie-Sitzungen bei speziell geschulten Therapeutinnen finanzieren, auch ohne Krankenversicherung. Die Therapeutinnen wurden vorher von uns im Umgang mit Sexarbeit sensibilisiert, um Pathologisierungen der Klient*innen zu vermeiden.
Was Hydra allerdings von anderen klassischen sozialarbeiterischen Projekten unterscheidet, ist, dass wir auch viel mit dem Peer-to-Peer Ansatz arbeiten. Das heißt, Sexarbeitende selbst schulen und oder beraten andere Sexarbeitende zu verschiedenen Themen.
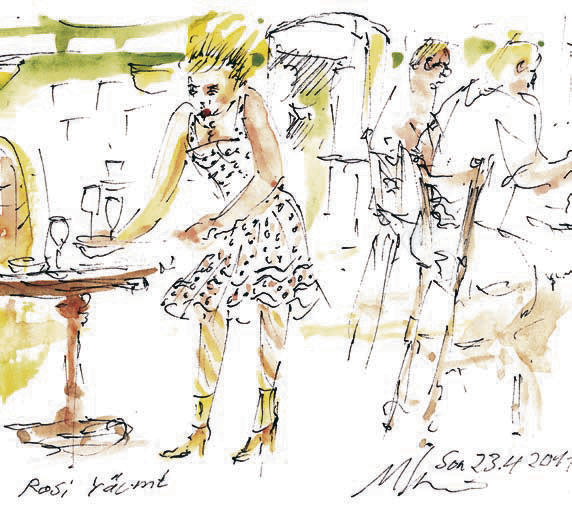
Der Berliner Senat hat ja für den Haushalt 2025/26 ziemlich beispiellose Kürzungen im Sozialbereich vorgenommen. Ist Hydra davon auch betroffen?
Ja. Es ist schon jetzt klar, dass wir im nächsten Jahr weniger Zuwendungsmittel erhalten werden – obwohl die Gehälter im TV-L, nach dem wir vergütet werden, eigentlich steigen. Und auch die Preise und Mieten sind ja insgesamt gestiegen. Die realen Kürzungen sind also noch größer, als die Zahlen es vermuten lassen. Wir wissen schon jetzt, dass wir unser Angebot nicht im selben Umfang werden aufrechterhalten können. Und das, obwohl der Rechtsanspruch aus dem Gewalthilfegesetz vor der Tür steht. Hier sollen die Mittel aus dem Gesetz offenbar die entstandenen Lücken stopfen. So wird sich aber für unsere Zielgruppe perspektivisch nicht viel verändern lassen.
Noch mal zurück zur Realität marginalisierter Sexarbeitender: Ich habe den Eindruck, dass die Aufwertung der Innenstadtbezirke die Existenz von Straßenstrichen immer weiter einschränkt. Stimmt das?
Ja, es gibt deutliche Anzeichen, dass das Phänomen Straßenstrich aus der Innenstadt vollkommen verdrängt werden wird. In der Kurfürstenstraße in Berlin-Schöneberg, wo viele trans Personen arbeiten, gibt es mittlerweile regelmäßig Konflikte mit Anwohner*innen. Eine ehrenamtliche Interessenvertretung namens TransSexWorks versucht dort zu intervenieren, mit Infoveranstaltungen, Nachbarschaftsgesprächen und Aufklärungsarbeit. Trotzdem gibt es viele Anwohner*innen, die den Straßenstrich vollständig aus dem Stadtbild entfernt sehen wollen. Und die zunehmende Aufwertung vieler Stadtteile – durch Gentrifizierung, aber auch durch die viel größer angelegte Aufwertung durch Immobilienkonzerne – führt dazu, dass Sexarbeit aus der Innenstadt immer weiter verdrängt wird. Berlin hat zwar (neben Rostock) als eine der wenigen Städte kein offizielles Sperrgebiet, aber trotzdem ist Sexarbeit vielerorts einfach unerwünscht, auch wenn sie drinnen stattfindet. Immer wieder haben Klientinnen Probleme mit Hausverwaltungen oder Eigentümergemeinschaften, zum Beispiel weil ein verärgerter Kunde sie bei der Hausverwaltung »verpfeift«.
Wirkt sich denn der Rechtsruck, den wir derzeit erleben, noch zusätzlich negativ auf den Bereich der Sexarbeit aus?
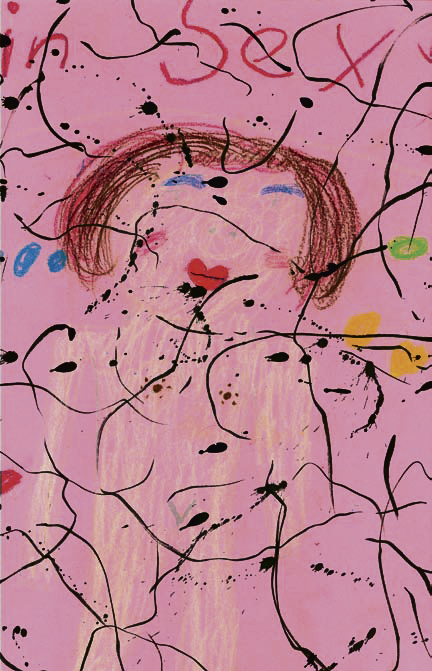
Es gehört schon immer zum Alltag von Sexarbeiter*innen, beschimpft, mit Müll beworfen oder bedroht zu werden, insbesondere auf der Straße. Im Nationalsozialismus wurden Sexarbeitende als sogenannte »Asoziale« verfolgt, entrechtet und ermordet. In rechten Ideologien ist für Menschen, die sich nicht konform verhalten, kein Platz, keine Empathie und keine Unterstützung. Das schadet der gesamten Gesellschaft, aber Sexarbeitende sind davon besonders stark bedroht. Immerhin gibt es mittlerweile ein Register zur Dokumentation von sexarbeitsfeindlichen Vorfällen, das an die Amadeu-Antonio-Stiftung angebunden ist.
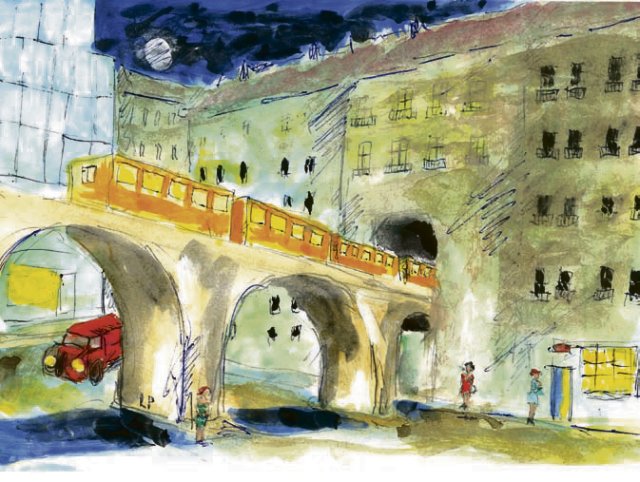
Was den allgemeinen Rechtsruck betrifft: Teilweise entsteht der Eindruck, dass sich gewisse Mitarbeitende in Behörden gezielt gegen bestimmte Gruppen stellen – besonders dann, wenn sie merken, dass sie durch die politische Lage mehr Rückendeckung haben. Insgesamt scheint hier teilweise schlicht Willkür im Spiel zu sein. So macht es einen riesigen Unterschied, ob eine Klientin eine wohlwollende Sachbearbeiterin erwischt oder eine Person mit rechtsgesinnten Tendenzen. Und vor allem bei Menschen aus Südosteuropa oder Drittstaaten sehen wir oft, dass eigentlich niemand zuständig sein will – Anträge versanden, Termine werden nicht vergeben, Antworten bleiben aus.
Scheint es Ihnen treffend, das aktuelle staatliche Handeln in diesen Bereichen als »rechte Sozialpolitik« zu beschreiben?
Ich würde sagen, in unserem Bereich lässt sich rechte Sozialpolitik durchaus ansatzweise beobachten, etwa in der Einschränkung von Unterstützungsberechtigungen. Die Gruppe der Personen, die überhaupt noch Anspruch auf Hilfe haben, wird immer weiter verkleinert. Teilweise wird etwa Obdachlosen aus Südosteuropa schlicht keine Unterstützung mehr gewährt – in Frankfurt mussten die Betroffenen zum Beispiel nach städtischer Anweisung in U-Bahn-Stationen schlafen. Wo diese Politik hinführen kann, zeigt sich im autoritär regierten Ungarn: Die Orbán-Regierung hat Frauenhäuser und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe fast ganz abgeschafft, Gewalt oder Armut sind dort weitestgehend zur Privatsache erklärt worden.
Das ProstSchG wurde 2024 einer Evaluation unterzogen. Gibt es hier schon Ergebnisse?
Ja. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat die über 900 Seiten starke Evaluation des ProstSchG im Juni diesen Jahres veröffentlicht, beauftragt vom Bundesfamilienministerium. In dem Rahmen war eine umfassende Umfrage unter Sexarbeiter*innen, Beratungsstellen, Behörden, Betreiber*innen und Kund*innen durchgeführt worden. Die Ergebnisse bestätigen im Grunde das, was wir seit vielen Jahren fordern: Entkriminalisierung wirkt schützend, das gesellschaftliche Stigma schadet den Sexarbeitenden, das Interesse der Behörden an stärkerer Kontrolle und Überwachung – insbesondere vonseiten des Finanzamts und der Polizei – steht mit dem Interesse am Schutz von Sexarbeitenden in Konflikt. Deshalb unterstützen wir die meisten Empfehlungen aus der Evaluation: Die Weitergabe von Daten aus der behördlichen Anmeldung der Sexarbeit muss aufhören, ebenso wie Scheinfreier-Einsätze der Polizei. Insgesamt können wir sagen, je weniger Auflagen Sexarbeitende erfüllen müssen, desto eher sind die besonders Marginalisierte unter ihnen vor Erpressung und Ausbeutung geschützt.

Irritierend war an der ganzen Angelegenheit allerdings, dass das Familienministerium am Tag der Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse ein regelrechtes PR-Event inszenierte. Die Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) posierte mit einem Theologen, Dr. Drobnik, der eine Studie präsentierte, für die Sexarbeitende – im Gegensatz zur KFN-Sudie – gar nicht befragt worden waren. Dr. Dobniks Studie propagierte das nordische Kriminalisierungsmodell, obwohl das den Ergebnissen der eigenen Evaluation entgegensteht. Damit ignoriert das Familienministerium seine selbst in Auftrag gegebene und gesetzlich verankerte, umfangreiche Evaluation – und inszeniert stattdessen ein Einzel‑Gutachten! Eine politische Bühne für eine deutlich abweichende Position zum Nordischen Modell gibt es nicht, obwohl der Koalitionsvertrag kein solches Verbot vorsieht. Diese Entwicklung, dass wissenschaftliche Ergebnisse einfach ignoriert werden, betrachten wir als sehr besorgniserregend.
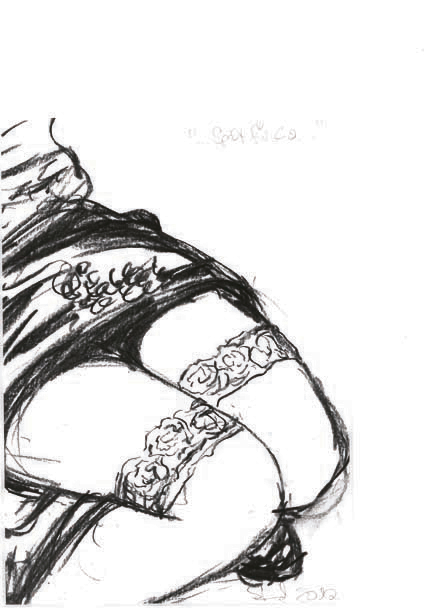
Wichtig ist es uns, an dieser Stelle auch auf den Gesetzesentwurf von Sexarbeitenden selbst hinzuweisen, der in mehreren Workshops erarbeitet und bereits am 2. Juni 2025 veröffentlicht wurde. Mit diesem Gesetzesentwurf liegt ein Dokument vor, das direkt aus der Perspektive von Sexarbeitenden selbst verfasst wurde. Es bündelt ihre Kritik an den bestehenden gesetzlichen Regelungen und beschreibt konkrete Forderungen und Maßnahmen zur wirklichen Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.